
Wiedergelesen: Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Ein Bericht von der Banalität des Bösen, erste deutsche Auflage Piper, München 1964
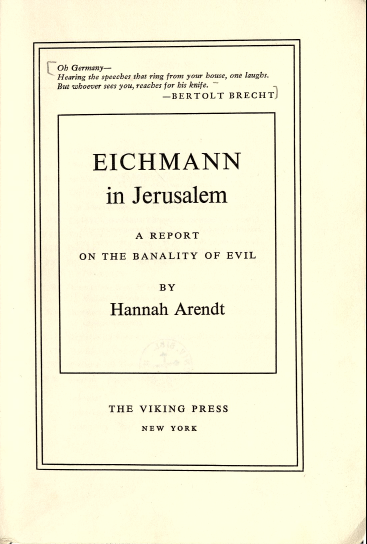
Vor sechzig Jahren begann Hannah Arendt ihre Artikelserie im „New Yorker“, die in überarbeiteter Fassung etwas später auch als Buch erschien: „Eichmann in Jerusalem“, Untertitel „Ein Bericht von der Banalität des Bösen“.
Es handelte sich um eine Reportage über den Prozess gegen den SS-Obersturmführer Adolf Eichmann, der die „Dienststelle IV B 4“ des Reichssicherheitshauptamt leitete. Dessen Abteilung war verantwortlich für die Verfolgung und Deportation von etwa 6 Millionen Juden im NS-besetzten Europa. Auch wenn das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt für die Konzentrations- und Vernichtungslager zuständig war, kam Eichmanns Abteilung doch die wesentliche Verantwortung für den Ablauf zu. Nach Kriegsende floh er mit falschem Pass nach Argentinien, holte seine Familie nach und arbeitete unter falschem Namen als Elektriker bei Daimler-Benz. 1960 wurde er durch den israelischen Geheimdienst entführt. In Jerusalem machte man ihm einen öffentlichen Prozess, verurteilte ihn in zwei Instanzen zum Tode und richtete ihn hin.

Ich habe mir als Student in den achtziger Jahren die damals frisch erschienene, Neuauflage mit einem „einleitenden Essay“ des Bochumer Historikers Hans Mommsen gekauft. An etlichen Stellen übte Mommsen harte Kritik an Arendt; las man das Buch von vorne nach hinten, lernte man zunächst Mommsens Kritik und danach Arendts Thesen kennen. In anderen Passagen lobte der Historiker die Philosophin und würdigte sie als Vorstufe seiner eigenen Geschichtsschreibung. Für die jüngeren Ausgaben (seit 2006) schrieb Mommsen auch noch ein Nachwort zum aktuellen Forschungsstand. Seither wird Arendt vorne und hinten durch Mommsen eingerahmt. Ich beschränke mich im Folgenden auf Arendt.
Arendt war keine professionelle Historikerin; sie schreibt, sie habe für ihren Bericht „durchgängig“ das Buch „Endlösung“ von Reitlinger herangezogen und sich quellenmäßig auf Raul Hilbergs die „Vernichtung der Europäischen Juden“ verlassen. Damals waren das die beiden wichtigsten Gesamtdarstellungen. An Details, die sich inzwischen als unzutreffend erwiesen haben, will ich nicht herummäkeln, zumal Arendt sie nicht alle selbst zu verantworten hat. Für meinen Geschmack geht auch der Vorwurf, Arendt ginge nicht mit kühler Rationalität an die Materie heran, am Problem vorbei. Gerade der Furor, mit dem sie schreibt, macht ihr Buch lesenswert. Damals wie heute wird ihr Buch vor allem deshalb gelesen, weil es nicht nüchtern und sachlich gehalten ist.
Eichmann, so schreibt sie, sei kein Ungeheuer und kein Judenhasser gewesen, schon gar nicht irgendwie dämonisch, sondern ein langweiliger Bürokrat, der unter anderen Bedingungen auch eine Schraubenfabrik hätte leiten können, ein gewöhnlicher Mensch mit Organisationstalent, unbeholfen und beschränkt, wenn auch keineswegs dumm. Der Eichmann, von dem sie so viel Schreckliches gelesen hatte, machte bei seinem Auftritt als Angeklagter in Jerusalem auf sie den Eindruck eines „Hanswurst“, beunruhigender Weise „schrecklich und erschreckend normal“ zugleich. Deshalb sprach sie von einer „Banalität des Bösen“, wobei „banal“ im englischen vor allem „üblich“ oder „verbreitet“ bedeutet, während die Nebenbedeutung „klein“ oder „unbedeutend“ vor allem im Deutschen und Französischen vorkommt, was möglicherweise einige Missverständnisse begünstigt hat. Für Arendt ist Eichmann ein Typus der arbeitsteiligen Moderne, ein Experte für effiziente Verwaltung, wie es viele gibt, auch wenn die meisten ihre Kompetenzen anders einsetzen als für die Organisation von Deportationen. Arendt spricht von „Verwaltungsmassenmord“, und unterscheidet diesen vom ‚gewöhnlichen‘ Völkermord, wie er seit der Antike häufiger vorgekommen sei. Für Arendt bleibt der „Verwaltungsmassenmord“ ein Mord, selbst wenn der „Schreibtischtäter“ dazu nicht einmal seinen Arbeitsplatz verlässt. Sie betont durchgehend die Möglichkeit, dass Eichmann sich anders hätte entscheiden können; als an Kant geschulte Philosophin hält sie an der Willensfreiheit fest. Sie will also beides zugleich, eine Strukturanalyse, die potenziell entmenschlichende Strukturen in der Verwaltung aufzeichnet, und die volle Verantwortlichkeit der in diesen Strukturen handelnden Menschen.
Noch in ihrem Totalitarismusbuch („Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, 1955 auf Deutsch erschienen) hatte Arendt mit dem Begriff des „radikal Bösen“ gearbeitet, den sie in einem Brief an den Philosophen Karl Jaspers definierte als „Überflüssigmachung von Menschen als Menschen“. Schlimmer als jede ‚gewöhnliche‘ Verletzung der Menschenwürde, die Menschen ‚nur‘ als Mittel zu fremden Zwecken missbraucht, mache das radikal Böse die Menschen qua Menschen „überflüssig“, behandele sie also nicht einmal mehr als Mittel für fremde Zwecke. Mit dem Eichmann-Buch änderte sie hier ihre Meinung oder akzentuierte zumindest anders. Jetzt sah sie im Angeklagten einen „Hanswurst“ und konnte ihm „beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen“.
Eichmann betonte als Angeklagter vor Gericht, dass er lediglich Befehlsempfänger gewesen sei, als ausführendes Organ keine Eigeninitiative gezeigt habe, und ihm persönlich antisemitische Ressentiments völlig fern gelegen hätten. Arendt hat ihm das weitgehend abgenommen – es passte auch zu ihrer These, dass Eichmann emotionslos Verwaltungsvorgänge abgearbeitet habe. Es gab allerdings Zeitgenossen wie z.B. Golo Mann, die Eichmann das nicht abnahmen und Arendt vorwarfen, sie sei auf die Verteidigungsstrategie des Angeklagten hereingefallen.
Erst sehr viel später wurden andere Quellen bekannt, die diese Kritik belegen konnten, darunter das vollständige Interview, das Eichmann 1957 noch vor seiner Verhaftung dem niederländischen Journalisten und ehemaligen SS-Mann Willem Sassen gewährt hatte: Damals wähnte Eichmann sich noch in Sicherheit, prahlte offensiv mit seinen „Leistungen“ bei der Judenvernichtung und war stolz auf das, was er „erreicht“ hatte. Das relativiert seine anderslautenden Aussagen vor Gericht. Auch den Lebenslauf Eichmanns, bevor er in „Referat IV B 4“ landete, kann man heute anders beurteilen als Arendt. Im Frühjahr 1938 leitete Eichmann noch die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien“, war nur für Österreich zuständig und hatte Kollegen bzw. Konkurrenten in Berlin und Prag. Im Vergleich mit den beiden anderen zeichnete er sich durch besondere Bosheiten aus, erzielte besonders große „Erfolge“ bei der Vertreibung der österreichischen Juden und wurde dafür von der NS-Führung mit einem Chefposten belohnt. Heute deutet man sein Verhalten in Wien entweder als besonders aggressiv ausgeprägten Antisemitismus oder als zweckrationale ‚Profilbildung‘, um Karriere zu machen. In beiden Deutungen zeigte er Eigeninitiative und erwies sich nicht als passiver Bürokrat.
Damit sind Arendts zugespitzte Thesen in Bezug auf Eichmann weitgehend widerlegt, nicht jedoch in gleichem Maße in Bezug auf andere Täterkreise. Der Historiker Christopher Browning untersuchte ein Hamburger Polizeibataillon, normale Leute („ordinary men“), Polizisten, die im Zweiten Weltkrieg als Reservisten zum Militär eingezogen wurden, und dort – weitgehend unvorbereitet – zu Massenerschießungen und der Mitwirkung an Deportationen abkommandiert wurden. Obwohl sie nicht gezwungen wurden, weigerte sich nur sehr wenige. Dafür macht Browning ganz Wesentlich den Korpsgeist innerhalb der Polizei und eine langjährige Einübung in Befehl und Gehorsam verantwortlich. Diesen Erklärungsansatz widersprach, zu wesentlichen Teilen aufgrund derselben Quellen, Daniel Goldhagen, der einen „eliminatorischen Antisemitismus“ auch bei vielen Polizisten des Polizeibataillons wirksam sah. Browning hat dem in einer Neuauflage erst kürzlich noch einmal widersprochen. Die Debatte kann an Arendt anknüpfen.
Damals ist Arendt in den USA und Israel heftig kritisiert worden. Dies liegt vor allem an denjenigen Passagen, in denen sie gegen die israelische Regierung, Staatsanwaltschaft und – zum Teil – auch gegen das Gericht polemisierte (gegen die Urteilsbegründung, nicht gegen die verhängte Strafe). Sie meinte, der Eichmann-Prozess werde zur Legitimierung der israelischen Regierung instrumentalisiert. Die antizionistische Zuspitzung ihrer Kritik erklärt sich wohl auch als Abgrenzung von einer eigenen stärker zionistischen Vergangenheit. Mir erscheint sie in dieser Schärfe nicht belegt. Ich hätte allerdings auch nicht erwartet, dass ein Prozess wie dieser sich in Israel im politikfreien Raum abspielt. Dass ein Gericht sich „normal“ benimmt, wenn ein derartiger Prozess mit einem derartigen Angeklagten abläuft und einige hundert Reporter:innen herumlaufen, mag als Ideal wünschenswert erscheinen. Realistisch ist es nicht. Dass ein Gericht Öffentlichkeitsarbeit betreibt, gehört heute zum Standard und ist nicht per se verwerflich.
Arendt polemisierte heftig gegen die vom nationalsozialistischen Regime eingesetzten „Judenräte“, die ihr eigenes Grab geschaufelt hätten, insbesondere gegen den von vielen sehr geachteten Leo Baeck. Selbstverständlich gab es unter denen Spitzel, Kollaborateure und Menschen, die ums eigene Überleben kämpften. Doch der Normalfall war das nicht. Viele hatten schlicht einen beschränkten Handlungsspielraum. Arendt kritisierte die „Judenräte“, ohne sie überhaupt untersucht zu haben, zum Teil aufgrund von Aussagen Eichmanns. Einer ihrer bis dahin besten Freunde, Gershom Scholem, warf ihr vor, es fehle ihr an „Herzenstakt“.
Scharf, allerdings von Mommsen im Vorwort relativiert, fiel Arendts Kritik an den bundesdeutschen Nachkriegsinstitutionen aus. Zu Recht glaubte sie, die Bundesregierung befürchte, mitten im bundesdeutschen Wahlkampf könne Kanzleramtschef Globkes Rolle, bis 1945 im Reichsinnenministerium, als Kommentator der Nürnberger Gesetze thematisiert werden. Arendt wusste noch nichts über die Rolle des Bundesnachrichtendienstes, dem der Aufenthaltsort und die Decknahmen Eichmanns seit 1952 bekannt waren, der aber in der Folgezeit von seinen ehemaligen SS-Kollegen bei der Organisation Gehlen bzw. beim BND gedeckt wurde, für den seinerseits Globke die Dienstaufsicht hatte. Das alles ist erst seit 2010 scheibchenweise bekannt geworden, wobei die Akteneinsicht durch den Rechtsweg (bis zum Bundesverwaltungsgericht) erzwungen werden musste. BND und Bundeskanzleramt haben immer das herausgerückt, was sie freigeben mussten. Bis heute kann die Eichmann-Akte beim BND nur unvollständig eingesehen werden. Weiteres wird hoffentlich in den nächsten Jahren durch die „Unabhängige Kommission“ zur Aufarbeitung der BND-Geschichte bekannt werden. Schon der heutige Kenntnisstand übersteigt Arendts schlimmsten Befürchtungen und Vermutungen.
Arents stark thetische Zuspitzung macht die Stärke und zugleich die Schwäche ihres Eichmann-Buchs aus. Es ist wie in einem Rausch geschrieben; alles ordnet sich ihrer einen These zu. Im Ergebnis missfällt mir ihr starkes Entweder-Oder. Beispielsweise finde ich nicht, dass Eichmann entweder Antisemit oder Bürokrat gewesen sein muss; er kann ja auch beides zugleich gewesen sein, ein antisemitischer Bürokrat oder ein bürokratischer Antisemit. Dennoch: Grade wegen Arendts stark thetischer Zuspitzung habe ich das Buch mit großem Gewinn wiedergelesen, lehrreich sowohl in denjenigen Passagen, in denen ich ihr zustimme, als auch in denen, in denen ich das nicht kann.




Pingback:Der BND bemüht sich um Aufklärung in eigener Sache - Himmelsleiter